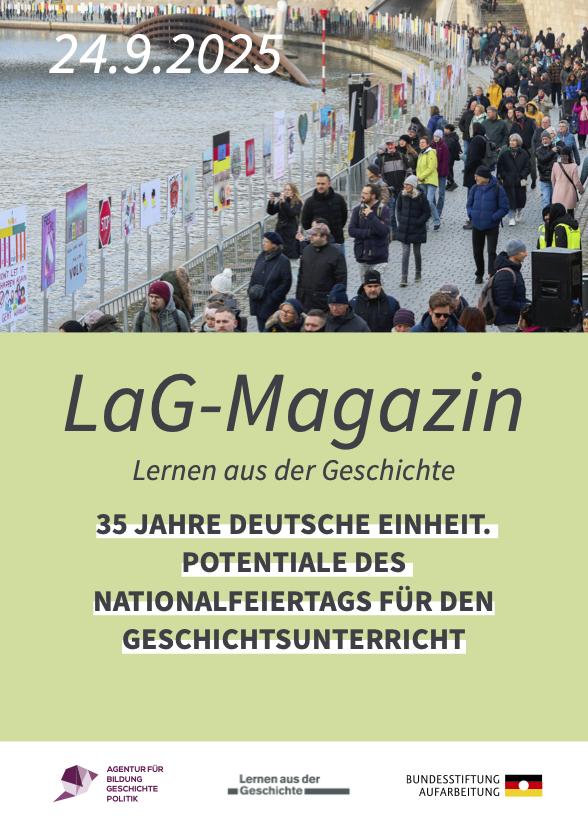Liebe Leser*innen,
die aktuelle Magazinausgabe erscheint zum Tag der Deutschen Einheit, der in Kürze zum 35. Mal gefeiert wird. Die Diskussionen um ihn, ob Zweifel, Kritik oder Befürwortung, währen auch schon viele Jahre lang. Wir wollen diese Debatte nicht ausführlicher nachzeichnen, sondern haben die Geschichtsdidaktiker*innen gefragt, wie sie diesen Tag für die Bildungsarbeit bewerten und welches Potential er birgt. Ebenso wenig diskutieren wir den − oft als „besseren“, wenn auch ambivalenten Nationalfeiertag ins Spiel gebrachten − 9. November. Denn auch dieser Tag verweist für das Jahr 1989 auf Regierungshandeln: Die Mauer fiel nicht, sie wurde von der DDR-Regierung geöffnet.
Stattdessen folgten wir Saskia Handros Hinweis auf den 9. Oktober 1989 in Leipzig. Über diesen Tag gibt es eine positiv besetzte Geschichte von 70.000 Demonstrierenden zu erzählen: Trotz der vorhergehenden gewaltsamen Auflösungen von Demonstrationen und Verhaftungen in jenem „Heißen Herbst“ boten die Leipziger*innen der Staatsmacht die Stirn. Umringt von bewaffneten Volkspolizisten und Stasi-Leuten zogen sie friedlich über den Innenstadtring. Dieser Tag steht für mutiges politisches Handeln mündiger Bürger*innen – eine Geschichte von Protest und Widerstand, die eines Nationalfeiertags würdig sein könnte. Auch die alte Bundesrepublik feierte jährlich am 17. Juni eine revolutionäre Erhebung, die allein Ostdeutsche getragen hatten, und erhob sie in den Rang eines nationalen Gedenktages. Doch 1990 zählte dieser Impuls nicht mehr, sondern der Wunsch, dass Deutschland wieder zusammenwächst. Die Entstehung beider Nationalfeiertage zeigt, dass weniger der durchaus normative Blick auf die Vergangenheit, sondern vielmehr eine auf die Zukunft gerichtete Wunschvorstellung mitunter ausschlaggebend ist.
Einige Beiträge dieser Ausgabe widmen sich älteren historischen Feier- und Gedenktraditionen und führen dabei weg von den Ereignissen von 1989/90. Jedoch werfen sie spannende Fragen auf: Wie gewöhnte die DDR ihre Bürger*innen 40 Jahre lang an das sozialistische Demonstrieren? Und wie entstand kürzlich, unter demokratischen Verhältnissen, ein neuer Feiertag, nämlich der Internationale Frauentag am 8. März in Berlin?
Insa Eschebach reflektiert über Gedenktage und -feiern seit der Weimarer Republik. Sie betrachtet keine Nationalfeiertage, regt aber zum Nachdenken über sie an: Hängt der Widerstand gegen solche Tage auch damit zusammen, dass sie nicht alle einbeziehen und damit nicht alle Mitglieder der Gesellschaft integrieren? Soll und muss ein Feier- und Gedenktag diesen Einschluss aller leisten? Und ist die Kritik am Frauentag unvermeidlich, weil er nicht alle ehrt, sondern die Interessen einer diskriminierten Gruppe gegen die Privilegien einer anderen stellt? Und wenn wir den Tag der Deutschen Einheit als identitätsstiftendes, einigendes Ereignis feiern – für wen war dieses historische Ereignis kein Grund zum Feiern oder sogar beängstigend?
Die Beiträge im Überblick:
Saskia Handro führt in die Geschichte des Tags der Deutschen Einheit ein. Sie diskutiert wesentliche Argumente der Kritik an diesem umstrittenen Feiertag und zeigt, wie sich seine Feierpraxis verändert hat.
Markus Drüding lotet die Möglichkeiten des Tags der Deutschen Einheit für die Bildungsarbeit aus. Er betont, dass dieser Tag keine klassische Gründungsgeschichte bereithält – eine Chance für Schüler*innen, an diesem Tag ihre eigene Geschichte zu erzählen.
Detlev Brunner und sein Forschungsteam haben die Feier- und Gedenkpraxis zum jährlich in Leipzig begangenen 9. Oktober untersucht. Er gibt uns einen Einblick in die Ergebnisse der Studie.
Thomas Ahbe beschreibt, wie die DDR den kämpferischen Protest der Arbeiterbewegung am 1. Mai in ein staatlich verordnetes Demonstrieren verwandelte. Die Ästhetik der Massenkundgebungen, Fackelzüge und Militärparaden erinnert jedoch an vorhergehende Zeiten.
Insa Eschebach analysiert die Gedenkpraxis seit der Weimarer Republik mit Blick auf Ein- und Ausschlüsse. Sie zeigt, dass auch nach 1945 nicht alle Toten in die kollektive Erinnerung an Krieg und Gewaltherrschaft aufgenommen wurden.
Wie es im Land Berlin 2019 zur Festlegung des Internationalen Frauentags am 8. März als gesetzlichem Feiertag kam, schildert uns Claudia von Gélieu aus erster Hand. Sie war selbst Teil der erfolgreichen Initiative des Netzwerks Frauen in Berlin-Neukölln.
Mit Hannes Burkhardt stellt uns ein Experte für das Lernen mit digitalen Medien drei Instagram-Posts zum Tag der Deutschen Einheit vor. Er verdeutlicht daran, wie Lehrkräfte im Geschichtsunterricht mit Sozialen Medien arbeiten können.
Benedikt Faber berichtet von den jährlichen Grevener Gedenktagen am dortigen Gymnasium Augustinianum. Die Schüler*innen gestalten die Gedenktage aktiv mit durch Ausstellungen, Vorträge und Podiumsdiskussionen mit namhaften Gästen.
Tobias Rischk reflektiert den 2003 produzierten bundesdeutschen TV-Film „Zwei Tage Hoffnung“, der zum 50. Jahrestag des 17. Juni 1953 in der ARD lief. Er betrachtet den Film im Kontext seiner erinnerungskulturellen Entstehungsgeschichte.
Diese Ausgabe wurde von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gefördert, dafür danken wir herzlich. Großer Dank gilt auch den Autor*innen: Ein Beitrag für das LaG-Magazin bedeutet mehr als Schreiben und Korrekturen bearbeiten. Es erfordert die Bereitschaft, den eigenen Text zu diskutieren; darüber hinaus mitunter die Konzeption des Heftes gemeinsam mit der Redaktion ein Stück des Weges mitzudenken, fachlichen Rat zu geben und weitere Autor*innen zu empfehlen. Mit der gebündelten Expertise dieses Themenhefts hoffen wir, Ihnen neue Blickwinkel zu eröffnen.
Das nächste LaG-Magazin ist bereits in Arbeit. Es erscheint am 17. Dezember 2025 und widmet sich einem weiteren kontroversen Thema: „Geschichte wird gemacht. Geschichtspolitik und Vermittlung von Demokratiegeschichte an umkämpften Orten“.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
Ihre LaG-Redaktion