„It’s all over … Vorbei! Geschafft! Erledigt! Man denkt nicht an das Kommende, nicht heute! Heute denkt und fühlt man nur: Uff …“ Dies schrieb Klaus Mann, der am 8. Mai 1945 als US-Soldat auf dem Weg von Italien nach Deutschland war und das Kriegsende auf der Durchreise in Salzburg erlebte, an seinen Vater Thomas Mann in New York.
Indes schrieb Astrid Lindgren in Stockholm am Vorabend des 8. Mai in ihr Tagebuch: „Dies ist der Tag des Siegs! Der Krieg ist aus! Der Krieg ist aus! DER KRIEG IST AUS! […] Über Stockholm liegt ein wahnsinniger Jubel […], alle Menschen führen sich auf, als wären sie verrückt. […] Ach, ach, jetzt ist Schluss mit Folter und Konzentrationslagern, Bombenangriffen und ‚Ausradierung‘ von Städten, und die gepeinigte Menschheit kommt vielleicht ein wenig zur Ruhe. […] Der Krieg ist aus – das ist das Einzige, was im Augenblick zählt.“
Der 8. Mai 1945 war eine Zäsur, die ganz Europa und wohl jede und jeden erfasste. Zeitgenössische Stimmen changierten zwischen Freude, Erleichterung und Erschöpfung. Auch wenn der Zweite Weltkrieg noch nicht beendet war – aus Europa war er gebannt und der Aggressor, der den Krieg begonnen hatte, das nationalsozialistische Deutschland, war besiegt. Eine neue Zeit brach an.
Auch heute, 80 Jahre später, blickt wieder ganz Europa auf den 8. Mai, mit je eigenen Perspektiven und Narrativen. In der Realität waren Befreiung und Kriegsende kein isolierbarer Zeitpunkt, sondern ein Zeitraum: Mit dem Voranschreiten der alliierten Armeen gingen viele Momente der Befreiung einher, nicht zuletzt die Befreiungen der Konzentrations- und Vernichtungslager, deren Jahrestage sich fest ins erinnerungskulturelle Bewusstsein eingeschrieben haben. Und auch nach dem 8. Mai waren nicht alle Traumata, alle Schmerzen auf einmal vorbei und vergessen. Die „Befreiung“ hatte für viele Menschen, vor allem für viele Überlebende, ganz unterschiedliche Gesichter. Und doch ist der 8. Mai eine Wegmarke, die uns daran erinnert, dass Unmenschlichkeit und Menschheitsverbrechen keine Naturgewalten sind, sondern ein Ende finden können. Besser gesagt: dass sie beendet werden können.
Hier in Deutschland wurde jahrzehntelang darum gerungen, den 8. Mai als Tag der Befreiung zu würdigen – in Berlin ist er im Jahr 2025 ein gesetzlicher Feiertag, in weiteren Bundesländern Gedenktag. Dies ist die Errungenschaft einer Gesellschaft, die sich der Aufarbeitung der NS-Verbrechen immer stärker geöffnet hat. Gleichzeitig sprechen manche politischen Kräfte wieder offen über einen „Tag der Niederlage“ – und diese politischen Kräfte werden stärker. Geschichtsrevisionismus nimmt zu, bei Weitem nicht nur hierzulande. Die Erinnerung an das nationalsozialistische Unrecht ist ebenso umkämpft wie die Erinnerung an das Kriegsende. Der 8. Mai ist ein Symbol, und Symbole lassen sich auf wirkmächtige Weise missbrauchen und überschreiben. Unter uns sind kaum noch Menschen, die das Kriegsende als Erwachsene erlebt haben. Dass verzerrende und revisionistische Erzählungen gerade jetzt stark zunehmen, wo diese Vergangenheit zunehmend historisiert wird, ist kein Zufall und auch kein Widerspruch.
Die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft setzt sich seit ihrer Gründung dafür ein, die Erinnerung an das NS-Unrecht lebendig zu halten – und zwar immer mit einem Blick, der auch über die deutschen Grenzen hinausgeht.
Mit dieser Ausgabe des Magazins „Lernen aus der Geschichte“ weiten wir den Blick auf die vielfältige europäische Erinnerungslandschaft. Wir lassen Facetten und Perspektiven zu Wort kommen, die hierzulande weniger bekannt sind, die aber in ihrer Gesamtheit den europäischen Erinnerungsraum ausmachen.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
Dr. Andrea Despot
Vorstandsvorsitzende der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft
Literatur
Lindgren, Astrid: Die Menschheit hat den Verstand verloren. Tagebücher 1939–1945, Berlin 2015, S. 298–299.
Mann, Klaus: Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht, Hamburg 2019, S. 806.
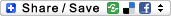
- |
- Seite drucken
- |
- 8 Mai 2025 - 09:44

