Wenn die DDR zum Feiern vorlud − zwischen Staatsakt und Volksfest
Thomas Ahbe
Die DDR beging viele Feste, Gedenk- und Feiertage, die sie mit ihren politischen Botschaften verband: Den Marsch zum Gedenken an die Ermordung Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs, den Internationalen Frauentag, die Jugendweihe, den Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus oder die SED-Erfindungen Plauener Spitzenfest oder Rudolstädter Fest des deutschen Volkstanzes.
Hier soll es zunächst um zwei hohe politische Feiertage der DDR gehen: den 1. Mai und das Gründungsjubiläum der DDR am 7. Oktober. Beide waren in der DDR arbeitsfrei und beide hatten ihre besonderen historischen Bezugspunkte, offiziellen Botschaften und Rituale.
Die Festsetzung der Feiertage und ihre offiziellen Botschaften
Mit dem Feiertag am 1. Mai – im offiziellen Sprachgebrauch der DDR „Internationaler Kampf- und Feiertag der Werktätigen“ – bezog sich die SED auf eine lange Tradition der internationalen Arbeiterbewegung. Sie hatte ihren Ursprung in den blutigen Auseinandersetzungen zwischen Unternehmern, Polizei und Arbeitern 1886 in Chicago. Zum „Kampftag der Arbeiterbewegung“ wurde der 1. Mai auf dem Gründungskongress der Zweiten Internationale 1889 ausgerufen. Seitdem streikten und demonstrierten an diesem Tag Arbeiter:innen auf der ganzen Welt für ihre Belange. Für Deutschland war der sogenannte „Blutmai“ von 1929 einschneidend. 1933 erklärten die Nationalsozialisten den 1. Mai zum „Tag der nationalen Arbeit“. An diesem Datum ließ sich fortan das NS-Regime auf Großkundgebungen durch die „Volksgemeinschaft“ bestätigen. Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus dekretierte dann die Sowjetische Militäradministration (SMAD) am 27. Dezember 1946 mit dem Befehl Nr. 361 den 1. Mai als „Kampf- und Feiertag der Arbeiterschaft“ – zunächst der einzige politische Feiertag ihres Besatzungsgebiets.
Die DDR modifizierte die Botschaft dieses Feiertages stark. Das Kämpferische des 1. Mai hatte im innenpolitischen Bereich keinen Platz mehr. Denn nun hatten nach Deutung der SED die „Arbeiter und Bauern“ die Macht im Lande. Einen „Kampf“ der DDR-Werktätigen gab es offiziell nur noch um die Erfüllung oder Übererfüllung der Pläne, um die Einführung neuer Technologien oder die Einsparung von Ressourcen oder Devisen. Der tradierte kämpferische Impuls des 1. Mai sollte sich nun symbolisch gegen die „imperialistischen Mächte“ richten. Wo Arbeiter:innen früher mit selbst gemalten Plakaten, Spruchbändern und einfachen Fahnen demonstrierten, wurden sie damit nun von Partei und Gewerkschaft ausgestattet. Jährlich im April veröffentlichte das Zentralkomitee der SED etwa 70 Losungen zu aktuellen innen- und außenpolitischen Themen. Im Jahre 1954 lauteten sie beispielweise: „Es lebe das Lager des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus, das unter Führung der Sowjetunion unbesiegbar ist!“ – „Brüderliche Grüße den Arbeitern in den kapitalistischen Ländern, die mutig und siegesgewiss gegen Krieg, Faschismus und Ausbeutung kämpfen!“ und „Gruß allen kolonialen und abhängigen Völkern, die für ihre Freiheit und nationale Unabhängigkeit gegen die imperialistischen Ausbeuter kämpfen!“ (Neues Deutschland 1954: 1).
Der 7. Oktober markiert als „Tag der Republik“, später auch als „Nationalfeiertag der DDR“ das Gründungsjubiläum. Am 7. Oktober 1949 konstituierte sich die Provisorische Volkskammer der DDR und rief die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik aus (Koch 1990: 355ff). Die Botschaft des 7. Oktobers vollendete den Jahreskreis des sozialistischen Festkalenders der DDR. Dieser begann mit dem Tag des Martyriums, setzte sich fort über den Tag der Wiederauferstehung und endete mit der Feier des Bestehenden (Gibas 2000: 199): Immer am zweiten Januar-Wochenende, somit nicht arbeitsfrei gestellt, gedachte man der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 15. Januar 1919 – die damit zu Märtyrern der linken Bewegung wurden. Der Verlust dieser theoretischen Köpfe und charismatischen Führungsfiguren war hier traumatisch, aber auch identitätsstiftend. Der 8. Mai als „Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus“ lässt sich als kommunistische Version der Auferstehungsgeschichte lesen. Der Feiertag wurde am 21. April 1950 verkündet und blieb bis 1966 arbeitsfrei. Der Feiertag zum 7. Oktober wurde im gleichen Gesetz wie der zum 8. Mai dekretiert und inhaltlich mit jenem verbunden. Da es ohne den 8. Mai 1945 keinen Neuanfang am 7. Oktober 1949 gegeben hätte, so führte DDR-Innenminister Karl Steinhoff in der Verordnung aus, gehörten der „Tag des Dankes an die Sowjetunion“ und der „Tag des Stolzes auf die eigene Leistung“ zusammen (Kitsche 1990: 17ff).

Demonstration zum 20. Jahrestag der DDR auf dem Marx-Engels-Platz, Berlin, 07.10.1969, © Hubert Link, Bundesarchiv Bild 183-H1205-1001-001
Die Symbole des neuen Staates
Am 13. September 1949 gab das SED-Politbüro eine Nationalhymne in Auftrag. Der neue Staatspräsident der DDR, Wilhelm Pieck schlug seinem Genossen, dem Dichter Johannes R. Becher, als Inhalt für die drei Verse vor: „Demokratie in Verbindung mit Kultur“, „Arbeit in Verbindung mit dem Wohlstand des Volkes“, „die Freundschaft mit den Völkern in Verbindung mit dem Frieden“. Der Refrain sollte die Einheit Deutschlands zum Inhalt haben (Amos 1997: 25ff). Das DDR-Staatswappen wurde schrittweise seit 1950 entwickelt (Gibas 1999: 252f) und am 27. Oktober 1955 dekretiert.
Die DDR-Feiertage und ihre Rituale
Die politisch gesetzten Festrituale der DDR entsprangen der Erfahrungswelt und den ästhetischen Vorstellungen der Gründergeneration an der SED-Spitze. Deren kulturelle Wurzeln lagen in der deutschen Arbeiterbewegung, insbesondere den Kämpfen der Weimarer Republik. Damals schlug sich politische Kraft in der Fähigkeit nieder, „die Massen“ zu mobilisieren. Sie zeigte sich darin, Kundgebungsorte oder die Straße mit Fahnen, Transparenten, Sprechchören und mit Fanfarenzügen nicht nur physisch, sondern auch symbolisch zu besetzen. Nun, nach 1945, hatte man den Nationalsozialismus überlebt und gesiegt! Und da bis zum Ende der DDR die SED-Gründergeneration, „die Generation der misstrauischen Patriarchen“, herrschte (Ahbe/Gries 2007), dominierte bei den zentralen Feier- und Gedenktagen auch die Ästhetik des proletarischen Klassenkampfes aus dem ersten Drittel des Jahrhunderts. Genau so sahen dann die Rituale zum 1. Mai und 7. Oktober aus: Massenkundgebungen und Demonstrationen, die in den SED-Medien gerne mit dem Attribut „machtvoll“ versehen wurden, Fackelzüge, bald auch Militärparaden. Für den 7. Oktober, dessen erster Jahrestag 1950 noch bescheiden begangen worden war, legte das DDR-Innenministerium dann im Vorfeld des zweiten Jahrestages die rituelle Form des Republikgeburtstags fest: „Am 6. Oktober 1951 finden in allen Schulen während des Unterrichts und in den Dienststellen der staatlichen Verwaltungen, den größeren volkseigenen Betrieben, den volkseigenen Gütern und Maschinen-Ausleihstationen außerhalb der Arbeitszeit Feiern anlässlich des 2jährigen Bestehens der Deutschen Demokratischen Republik statt. Am Sonntag, den 7. Oktober 1951, werden in den Gemeinden und Städten öffentliche Festveranstaltungen durchgeführt. An beiden Tagen sind sämtliche Dienstgebäude zu beflaggen und auszuschmücken. Die Bevölkerung wird aufgefordert, ebenfalls ihre Häuser mit Fahnen der Republik und der demokratischen Parteien und Massenorganisationen zu schmücken.“ (Kitsche 1990: 24f).

Fackelzug der FDJ und der Pionierorganisation "Ernst Thälmann" zum 25. Jahrestag der DDR, Unter den Linden Ost-Berlin, 06.10.1974, © Klaus Franke, Bundesarchiv Bild 183-N1006-432
Zwar erreichte auch die DDR seit den 1960er Jahren der Trend zur Individualisierung, zur Ausbildung neuer sozialer Milieus und Kulturmuster. Dieser Wandel blieb jedoch auf der Ebene der feierlichen, ohnehin mit den Mitteln der Diktatur geschützten Repräsentation der Staatsidee wirkungslos. Bei den hohen sozialistischen Feiertagen hatten diese Rituale Bestand. Die Funktionär:innen wie auch die Vorgesetzten nötigten die Menschen mit hohem sozialem Druck zur Teilnahme an den ritualisierten Demonstrationen und Kundgebungen. Die Grenze zwischen dem Privatleben und den Anforderungen von Schule, Betrieben und Universitäten waren hier aufgehoben. Für die mittleren und jüngeren Generationen, selbst wenn sie unpolitisch oder prosozialistisch eingestellt waren, wurden diese Rituale schon allein wegen ihrer Form und Ästhetik zunehmend unverständlich, ja abstoßend. Hier wurden für ein paar Stunden die Körper der Menschen okkupiert. Die jungen Menschen bewegten sich seit den Sechzigern in der Rhythmik der Beat-, Rock- und Popmusik. Doch auf den Demonstrationen wurden sie in den geraden Takt, bisweilen auch Gleichschritt der Märsche genötigt, zu Sprechchören, was schon unabhängig von den Inhalten befremdlich und antiquiert wirkte.
In den Demonstrationszügen richtete sich die Reihenfolge der betrieblichen Abordnungen meist an den Ergebnissen in der Planerfüllung aus. Tribünensprecher:innen begrüßten die Marschblöcke der Betriebe über Lautsprecheranlagen und hoben die Resultate und Verpflichtungen hervor, was die Tribüne mit Beifall quittierte. Zudem soufflierten die Lautsprecher die Losungen, die die Marschierenden der Tribüne zuriefen, die ihrerseits ihre Winkelemente schwenkten. An der Tribüne großer Städte mischte sich so Marschmusik mit pathetisch vorgetragenen Erfolgsmeldungen aus den Lausprechern, dem darauffolgenden Applaus der Tribünengäste und den Hochrufen der Demonstrant:innen zu einer Stunden währenden Kakofonie.
Versuche, den Demonstrationen fernzubleiben, hatten nicht das Gewicht expliziter politischer Proteste, auf die mit Sicherheit eine Reaktion des Staates folgte. Sie konnten unbemerkt bleiben oder als Lappalie behandelt werden. Es konnte auch die „Stellungnahme im Kollektiv“ eingefordert werden – nervend genug, oder gravierender: eine negative Beurteilung in Schule, Ausbildung oder Studium erfolgen. Die Reaktionen und Bedingungen waren hier unterschiedlich – eine Unkalkulierbarkeit, die bedrückend war. So versuchten die meisten Menschen dem Kleinkrieg um die Teilnahme auszuweichen, indem sie die Demonstrationsstrecke bis zur Tribüne, auf der die lokalen Vertreter:innen der Parteien, Organisationen, der Staatsorgane und die „ausgezeichneten Werktätigen“ standen, pflichtgemäß absolvierten – um den Rest des Tages mit der Familie, Kolleg:innen oder Freunden auf den Volksfesten oder im privaten Rahmen zu entspannen.
Das Nachleben der DDR-Feiertage
Der letzte 1.-Mai-Feiertag der DDR wurde 1990 bereits nach bundesdeutschen Gepflogenheiten begangen (DEFA-Stiftung). Nach dem Beitritt der DDR wendeten sich Arbeitskämpfe und Proteste gegen die Treuhand-Entscheidungen und gegen akute Problemlagen – auf den 1. Mai konnte man nicht warten. Im Übrigen waren nach dem Erlebnis der erfolgreichen Herbstrevolution von 1989 die Montagsdemonstrationen viel symbolträchtiger als der alte DDR-Staatsfeiertag vom 1. Mai. So erlebten die Proteste gegen die Massenentlassungen in Ostdeutschland ihren Höhepunkt am 18. März 1991 – einem Montag – in Leipzig. 70.000 Beschäftigte aus Betrieben und Verwaltungen, die von Massenentlassungen betroffen oder bedroht waren, gingen dort auf die Straße (Rink/Burchardt 2020: 59).
Der Feiertag vom 7. Oktober entfiel mit dem Ende der DDR, er hat auch kein Nachleben. Kurz vor dem alten Datum wurde eine neue Markierung dekretiert: „Der 3. Oktober ist als Tag der Deutschen Einheit gesetzlicher Feiertag“, vermerkt hierzu Artikel 2 des Einigungsvertrags (von Münch 1991: 328). Der bereits in der Weimarer Republik bekannte Gedenkmarsch für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wird heute von verschiedenen politischen Gruppen organisiert. Er führt zwar weiterhin in die von der DDR errichtete „Gedenkstätte der Sozialisten“ in Berlin-Friedrichsfelde. Diese wurde aber 2006 um die Gedenktafel „Den Opfern des Stalinismus“ erweitert und so auch für weitere Gruppen akzeptabel.
Bei manchen sozialistischen Feiertagen und Festen zeigte sich nach 1990, dass deren Einbindung in das Leben der Ostdeutschen und deren Wertvorstellungen in den 40 Jahren der DDR offensichtlich recht stabil geworden waren. So wandelte sich etwa der Internationale Frauentag am 8. März vom sozialistisch gesetzten Ritual zum Brauch, der in Ostdeutschland vielfach noch gepflegt wird. Er wird in ostdeutschen Familien nun zusätzlich zum Muttertag zelebriert, zudem spielt er im Arbeitsleben hier und dort immer noch eine Rolle. Auch die Jugendweihe wird in Ostdeutschland noch mehrheitlich als Passagenritual bevorzugt. Die unzähligen Brigadefeiern innerhalb und außerhalb des „sozialistischen Titelkampfes“ haben auch ein Nachleben. Die Angehörigen so mancher Brigaden treffen sich auch heute noch regelmäßig (Lühr 2025: 309ff). Andere reine SED-Kreationen wurden modernisiert: Die Plauener führten ihr Spitzenfest nach dem Ende der DDR nahtlos weiter, 2025 wird die Veranstaltung zum 64. Mal ausgerichtet (Stadt Plauen 2025). Es ist nun ein von der Bürgerschaft getragenes Stadtfest wie viele andere auch. Das ebenfalls 1955 gegründete Rudolstädter Festival erlebte 1991 einen Neustart. Es wurde weltoffen, nahm eine rasante Entwicklung und fand in diesem Jahr zum dreiunddreißigsten Mal als Weltmusikfestival statt (Platzdasch 2025: 11; Rudolstadt-Festival 2025).
Ahbe, Thomas: Feiertage der DDR – Feiern in der DDR. Zwischen Umerziehung und Eigensinn, Erfurt 2017.
Ahbe, Thomas/Gries, Rainer: Geschichte der Generationen in der DDR und in Ostdeutschland. Ein Panorama, Erfurt 2007.
Amos, Heike: Auferstanden aus Ruinen... Die Nationalhymne der DDR 1949-1990, Berlin 1997.
DEFA-Stiftung Filme: Filmdatenbank. Film 1. Mai 1990, in: Defa Stiftung, URL: https://www.defa-stiftung.de/filme/filme-suchen/1-mai-1990/ [eingesehen am 23.08.2025].
Gibas, Monika: „Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt“. Politische Feier- und Gedenktage der DDR, in: Behrenbeck, Sabine/Nützenadel, Alexander (Hrsg.): Inszenierungen des Nationalstaats. Politische Feiern in Italien und Deutschland seit 1860/71, Köln 2000, S. 191–220.
Gibas, Monika: „Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt...“ Die Metaerzählung zum 7. Oktober, in: dies. et al. (Hrsg.): Wiedergeburten. Zur Geschichte der runden Jahrestage der DDR, Leipzig 1999, S. 247–263.
Kitsche, Matthias: Die Geschichte eines Staatsfeiertages. Der 7. Oktober in der DDR 1950–1989, Köln 1990.
Koch, Manfred: Volkskongressbewegung und Volksrat, in: Broszat, Martin/Weber, Hermann (Hrsg.): SBZ-Handbuch. Staatliche Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche Organisationen und ihre Führungskräfte in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945−1949, München 1990, S. 349–357.
Losungen des ZK der SED zum 1. Mai 1954, in: Neues Deutschland, 16.04.1954, S. 1, in: jstor.org, URL: https://www.jstor.org/stable/44924914 [eingesehen am 24.08.2025].
Lühr, Merve: Erinnern an die Arbeit im Kollektiv. Retrospektive Deutungen des Brigadelebens in der DDR, Leipzig 2025.
von Münch, Ingo (Hrsg.): Dokumente der Wiedervereinigung Deutschlands, Stuttgart 1991.
Platzdasch, Günter: Wer miteinander tanzt, wird nicht aufeinander schießen. Was haben die Folktradition der DDR, iranische Hits und Musik aus Mali gemein? Auf dem Rudolstadt-Festival lässt es sich herausfinden, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.07.2025, S. 11.
Rink, Dieter/Burchardt, Susann: Apathie oder Aufbegehren? Proteste in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, in: Hofmann, Michael (Hrsg.): Umbruchserfahrungen. Geschichten des deutschen Wandels von 1990 bis 2020, Münster 2020, S. 55–70.
Rudolstadt-Festival: Über uns, Website zum Festival 2025, in: Rudolstadt Festival, URL: https://www.rudolstadt-festival.de/allgemeines/ueber-das-festival.html [eingesehen am 09.08.2025].
Stadt Plauen: Plauener Spitzenfest, Website zum Fest 2025, in: plauen.de, URL: https://www.plauen.de/Tourismus-Kultur-und-Freizeit/Veranstaltungen/Veranstaltungshighlights/Plauener-Spitzenfest/ [eingesehen am 09.08.2025].
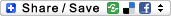
- |
- Seite drucken
- |
- 24 Sep 2025 - 10:49

