„Wenn man was tut, dann muss man's eben aus Überzeugung tun!“ Wehrdienst- und Totalverweigerer in der Untersuchungshaftanstalt in der Keibelstraße
Henrike Voigtländer und Jan Haverkamp
In der DDR befand sich zwischen 1951 und 1990 in der Keibelstraße am Alexanderplatz die „Untersuchungshaftanstalt Berlin-Mitte“, später „Untersuchungshaftanstalt II (UHA II)“. Sie war dem Ministerium des Innern unterstellt und lag innerhalb des Ost-Berliner Präsidiums der Volkspolizei. Im Untersuchungsgefängnis waren Personen aufgrund verschiedener Tatvorwürfe inhaftiert, die von gewöhnlicher Kriminalität über soziale Abweichung bis hin zu politischen Delikten wie „Staatsfeindlicher Hetze“ reichten. In der Keibelstraße warteten die Inhaftierten auf den Ausgang der Ermittlungen und des Gerichtsverfahrens, bevor sie entlassen oder – in den meisten Fällen – in andere Gefängnisse oder Haftarbeitslager republikweit gebracht wurden.
Inhaftiert in der Keibelstraße
Mit der Einführung der Wehrpflicht im Jahr 1962 konnten DDR-Bürger in die Untersuchungshaftanstalt in der Keibelstraße gelangen, die den Wehrdienst verweigerten. Denn wer sich den Aufforderungen des Wehrkreiskommandos zur Erfassung und Musterung oder dem Einberufungsbefehl zur Ableistung des Wehrdienstes entzog, musste mit mehrjährigen Gefängnisstrafen rechnen. Die 1964 eingeführte Regelung für einen waffenlosen Ersatzdienst schuf die Möglichkeit, ihn als „Bausoldat“ oder „Spatensoldat“ im militärischen und öffentlichen Bauwesen zu absolvieren. Doch auch dieser Dienst blieb militärisch ─ Bausoldaten hatten ein Gelöbnis abzulegen, also militärischen Gehorsam zu leisten. Lehnten Menschen den Ersatzdienst ebenso ab, galten sie als Totalverweigerer, welche Militärgerichte in der Praxis mit Freiheitsstrafen von bis zu 22 Monaten verurteilten (Koch 1995: 1848).
Wie viele Wehrdienstverweigerer in der Keibelstraße inhaftiert waren und in welche Gefängnisse sie im Anschluss an die Untersuchungshaft gebracht wurden, ist aufgrund der noch ausstehenden Forschung zum Ort bisher nicht bekannt. Hinweise liefern aber die Erzählungen von Zeitzeugen, die in der UHA II einsaßen:
Bernd Quinque war im November 1973 für etwa zwei Wochen in der Untersuchungshaftanstalt am Alexanderplatz. Der Baufacharbeiter hatte mehrfach die Einberufung zum Wehrdienst und auch zum Ersatzdienst als Bausoldat aus religiösen Gründen verweigert. Denn Quinque gehörte den Zeug*innen Jehovas an, deren Glaubensgrundsätzen der Wehrersatzdienst widersprach und die den Großteil der verurteilten Totalverweigerer in der DDR stellten. Von der UHA II kam Quinque in verschiedene Strafvollzugseinrichtungen u. a. nach Raßnitz und Halle, bevor er im Juli 1975 aus der Haft entlassen wurde (Interview Quinque 2019: 38f).
Ein weiterer Totalverweigerer, der allerdings nicht aus religiösen Motiven den Dienst an der Waffe verweigerte, war Michael Schuhhardt. Schuhhardt, der 1980 eine Ausbildung zum Maskenbildner beim Fernsehen der DDR begonnen hatte, drängte schon früh der Wunsch, die Welt zu bereisen, aber vor allem auch den westlichen Teil Berlins zu besichtigen. Mit der Zeit fühlte sich Schuhhardt immer stärker eingesperrt und stellte schließlich im Spätsommer 1984 einen Ausreiseantrag (Interview Schuhhardt 2020: 7f). Hierdurch verlor er seinen Beruf und seine Aussicht auf ein Studium. Gleichzeitig entschied er konsequenterweise, den Wehrdienst zu verweigern, da er dem Staat, aus dem er auszureisen wünschte, nicht mehr dienen wollte. Allerdings verwehrten ihm die Militärbehörden den angestrebten Bausoldatendienst, so dass ihm nur die Totalverweigerung blieb. Am 2. November 1984 wurde er schließlich verhaftet und in die UHA II gebracht. Von der Keibelstraße aus kam er am 22. Dezember 1984 in die Strafvollzugsanstalt Thale. Im Juli 1986 wurde Schuhhardt aus der Haft entlassen. Er bekräftigte erneut seinen Ausreisewunsch, verweigerte Maßnahmen zur Wiedereingliederung und konnte schließlich ein Jahr später nach West-Berlin ausreisen (Interview Schuhhardt 2020: 45f).
Wehrdienst- und Totalverweigerung in der Bildungsarbeit am Lernort Keibelstraße
Für Schulklassen der Sekundarstufe I und II bietet der Lernort Keibelstraße innerhalb mehrerer Lernwerkstätten das Thema des Militärdienstes in der DDR und dessen Ablehnung an: In den Workshops zu den verschiedenen Inhaftierungsgründen setzen sich die Lernenden mit den gesetzlichen Bedingungen des Wehr- und Ersatzdienstes sowie den Möglichkeiten und den Konsequenzen der Verweigerung auseinander. Sie beschäftigen sich mit Biografien von Inhaftierten, mit der Situation der seit 1950 in der DDR verbotenen Zeug*innen Jehovas oder dem 1986 gegründeten „Freundeskreis der Wehrdiensttotalverweigerer“. Dabei wird die Bedeutung der allgemeinen Militarisierung der Gesellschaft der DDR vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs vermittelt. In einem weiteren Bildungsangebot für Abiturklassen zur Friedensbewegung in der Bundesrepublik und der DDR setzen sich Schüler*innen mit den unterschiedlichen Handlungsspielräumen von Wehrdienstverweigerern in demokratisch verfassten Gesellschaften und in diktatorischen Systemen auseinander.
In diesen Formaten werden als Gegenwartsbezug immer wieder aktuelle Debatten aufgegriffen. Eine große Rolle spielt zum Beispiel die Diskussion um die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland in Folge der russischen Vollinvasion in die Ukraine, die für Jugendliche unmittelbare Folgen für ihr eigenes Leben hat und eine eigene Positionierung erfordert. Durch die Verknüpfung der Vergangenheit mit den Fragestellungen der Jugendlichen aus ihrer heutigen Situation heraus kann das Interesse für historische Konstellationen geweckt sowie ein kritisches Geschichtsbewusstsein gefördert werden.
Für mehr Informationen zu unseren Bildungsformaten besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren uns unter kontakt [at] keibelstrasse [dot] de. Wir beraten Sie gerne bei der Wahl des passenden Bildungsangebots!
Anmerkung:
Das im Titel genannte Zitat stammt von Bernd Quinque, der als Totalverweigerer 1973 in die Untersuchungshaft kam (Interview Quinque 2019: 60).
Literatur
Agentur für Bildung, Geschichte und Politik e.V.: Interview mit Bernd Quinque vom 3.12.2019, Transkript, (einsehbar bei der Robert-Havemann-Gesellschaft/Archiv der DDR-Opposition e.V., Berlin).
Agentur für Bildung, Geschichte und Politik e.V.: Interview mit Michael Schuhhardt vom 14.1.2020, Transkript, (einsehbar bei der Robert-Havemann-Gesellschaft/Archiv der DDR-Opposition e.V., Berlin).
Koch, Uwe: Die Baueinheiten der Nationalen Volksarmee der DDR – Einrichtung, Entwicklung und Bedeutung, in: Deutscher Bundestag (Hrsg.): Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“, Bd. II/3: Machtstrukturen und Entscheidungsmechanismen im SED-Staat und die Frage der Verantwortung, Baden-Baden 1995, S. 1835–1891.
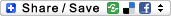
- |
- Seite drucken
- |
- 2 Jul 2025 - 08:31

