„Unwürdige Opfer“: Ein- und Ausschlüsse in der deutschen Erinnerungskultur
Insa Eschebach
Gedenkveranstaltungen sind Foren, auf denen eine Gesellschaft oder Gruppe die „Idee, die sie sich von sich selber macht“, zur Darstellung bringt (Durkheim 1994: 566). Als kleine geschlossene Welten gleichen sie einem Spiegel, der die herrschenden sozialen und politischen Verhältnisse in einer verklärenden Form reproduziert. Gedenkveranstaltungen dienen dazu, die moralische Ordnung der res publica zu stärken. Aus der Erinnerung an eine kollektive Gewalterfahrung und der Ehrung der Toten werden Handlungsprämissen für die Zukunft abgeleitet.
Öffentliche Gedenkakte basieren jedoch immer auch auf Ausschlussprinzipien. Das betrifft zunächst das historische Ereignis selbst und die Toten, derer gedacht wird. Was in den Rang einer öffentlichen Erinnerung gehoben wird, ist stets „von den Rändern des Vergessens profiliert“ (Assmann 1999: 408). Schon Friedrich Nietzsches Kritik religiöser oder „kriegerischer“ Gedenktage galt der Tatsache, dass „ganze große Theile“ des Vergangenen „vergessen“ und „verachtet“ werden: „Sie fliessen fort wie eine graue ununterbrochene Fluth, und nur einzelne geschmückte Facta heben sich als Inseln heraus“ (Nietzsche 1980: 26ff).
Auch Tote und Verfolgte, denen keine öffentliche Wertschätzung zuteilwird, geraten in Vergessenheit. Gedenken bedeutet immer auch Ehren, und nicht alle, die im Rahmen kollektiver Gewalterfahrungen – in Kriegen, in Gefangenschaft, in Konzentrations- und Vernichtungslagern – ihr Leben verloren, werden nachträglich mit Ehrungen bedacht. Der Ausschluss einer Gruppe von Toten aus öffentlichen Akten des Gedenkens geht häufig Hand in Hand mit dem Ausschluss derer, die dieser Toten gedenken wollen. Meine These lautet, dass autoritäre Gesellschaften mit ihren holzschnittartigen Geschichtsbildern stärkere Ein- und Ausschlüsse praktizieren als Demokratien, in denen Einsprüche und „Erinnerungsproteste“ weitgehend zulässig sind.
Heldengedenken in der Weimarer Republik
Als am 18. September 1927 die Weihe des Tannenberg-Nationaldenkmals in Ostpreußen stattfand, war zunächst auch die Rede eines jüdischen Feldgeistlichen vorgesehen. Das größte deutsche Kriegerdenkmal war den Deutschen gewidmet, die in der Schlacht an den Masurischen Seen und der sogenannten Tannenberg-Schlacht 1914 gefallen waren. Bekanntlich kämpften im Ersten Weltkrieg etwa 100.000 jüdische Soldaten für Deutschland, sodass ihre Ehrung am Tannenberg-Nationaldenkmal eigentlich selbstverständlich war. Dennoch verweigerte man dem jüdischen Feldgeistlichen mit dem fadenscheinigen Argument der zu knapp bemessenen Zeit das Wort. Der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten protestierte gegen diesen Ausschluss und nannte ihn eine „Entehrung des Andenkens der Gefallenen“; auf diese Weise sei zudem den „jüdischen Frontsoldaten die Beteiligung“ am Festakt „unmöglich gemacht“ worden (Tietz 1999: 54).
Bereits 1924, während der jährlichen Gedenkfeier zur Ehrung gefallener Soldaten, der sogenannten Heldengedenkfeier in Berlin, konnte kein Rabbiner eine Ansprache halten. Stattdessen veranstaltete der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten im Anschluss an den Staatsakt eine Gedenkfeier auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee. Rabbiner Leo Baeck brachte in seiner Rede resigniert zum Ausdruck, dass „all die Liebe und Aufopferung für das Vaterland […] vergeblich gewesen“ seien (Eschebach 2005: 79f).
Deutlich wird, dass mit der Entnennung der jüdischen Toten des Ersten Weltkrieges zugleich die Existenz von Juden und Jüdinnen in der Gesellschaft verschwiegen wurde. Sie waren mit Begriffen wie „Deutschland“, „unser Volk“ fortan nicht mehr gemeint. Immerhin aber konnten damals die Ausschlusspraktiken anlässlich der Gedenkfeiern noch öffentlich bekannt gemacht und kommentiert werden, so im Berliner Tageblatt und anderen Zeitschriften. Im "Dritten Reich", das alle Medien "gleichschaltete" und öffentliche Veranstaltungen nur noch der Repräsentation eines reinen, homogenen Volkskörpers dienten, war selbst das nicht mehr möglich.
Selektive Gedenkpraxis nach 1945 in beiden deutschen Staaten
Kontinuitäten gesellschaftlicher Diskriminierung und Ausgrenzung zeigten sich unmittelbar nach der Befreiung u. a. in der Entschädigungspraxis früherer NS-Verfolgter. All jene, die aus sozialen und rassistischen Gründen verfolgt worden waren, galten als "unwürdige Opfer" (zur Nieden 2003). Vorherrschend war ein heroisch überhöhtes Bild des Widerstandes. Frauen und Männern mit sozial abweichendem oder mit politisch unerwünschtem Verhalten wurde auch in den KZ-Gedenkstätten kein Forum geboten.
Das galt nicht nur für die SBZ und spätere DDR, sondern in geringerem Maße auch für die Bundesrepublik, wie folgendes Beispiel zeigt: Wenige Tage nach der Eröffnung der Gedenkstätte Neuengamme am 7. November 1965 beschnitt die Hamburger Kriminalpolizei einen Kranz, den eine Delegation der „Sowjetischen Besatzungszone“ niedergelegt hatte. Hammer und Sichel auf einer Kranzschleife wurden damals als eine „Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ wahrgenommen (Lange 1996). Die Zensur von Kranzschleifen hatte sich bereits Anfang des 20. Jahrhunderts als probates Mittel staatlicher Aufsicht erwiesen: Beispielsweise kontrollierte die Preußische Polizei die Schleifen von Kränzen, die bei Gedenkfeiern auf dem Friedhof der Märzgefallenen in Berlin-Friedrichshain niedergelegt worden waren.
Kranzschleifen mit unerwünschten Widmungen galten auch dem Ministerium für Staatssicherheit der DDR (MfS) als Skandalon: Als anlässlich des 40. Jahrestages der Befreiung des KZ Ravensbrück 1985 der Arbeitskreis Homosexuelle Selbsthilfe – Lesben in der Kirche in der Gedenkstätte lesbischer Häftlinge gedenken wollte, wurden auf Anordnung des MfS neue Kränze über seinen Kranz gelegt. Ein Besucherbuch, in dem die Gäste mit einer Eintragung an die homosexuellen Häftlinge im KZ erinnerten, zog die Gedenkstätte aus dem Verkehr. Auf diese Weise verwehrte man jenen, die kein sichtbarer Teil der sozialistischen Gemeinschaft der DDR sein sollten, zugleich den Zugang zur Geschichte des Frauen-KZ Ravensbrück (Eschebach 2019: 54). Ähnlich erging es dem Arbeitskreis Homosexualität der Evangelischen Studentengemeinde Leipzig, deren in der Gedenkstätte Buchenwald 1987 niedergelegter Kranz mit der Widmung „Wir gedenken Tausender ermordeter homosexueller Häftlinge“ entfernt wurde.
Aber auch in Westdeutschland erwies sich die erinnerungskulturelle Inklusion der als homosexuell verfolgten KZ-Häftlinge als ein mühsamer Prozess. Als 1985 in der KZ-Gedenkstätte Dachau ein Gedenkstein zur Erinnerung an die homosexuellen Häftlinge gestiftet wurde, suchte das Comité International de Dachau dessen Aufstellung zu verhindern. Der Gedenkstein fand Obdach in der Evangelischen Versöhnungskirche auf dem Gedenkstättenareal, bis er schließlich 1995 legalisiert wurde.
Die schrittweise Inklusion "unwürdiger" NS-Verfolgter in die Erinnerungskultur Deutschlands ist immer auch Ausdruck zeitgleich verlaufender gesellschaftlicher Emanzipationsprozesse: In dem Verhältnis, in dem Homosexualität als soziale Lebensform in westeuropäischen Gesellschaften akzeptiert wurde, wurden auch die Gruppen zuvor geächteter homosexueller NS-Verfolgter als gedenkwürdig betrachtet (Vehse 2023). Das betrifft beispielsweise auch die große Gruppe der Sinti und Roma, die zur NS-Zeit als „fremdrassig“ und „geborene Asoziale“ verfolgt wurden; auch ihnen wurde jahrzehntelang jedes offizielle Gedenken verweigert. Erst seit 2012 erinnert ein Denkmal im Berliner Tiergarten an die schätzungsweise 500.000 ermordeten Frauen, Männer und Kinder der Minderheit. Ähnliches gilt für die zur NS-Zeit verfolgten Zeugen Jehovas, deren Religionsgemeinschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts nach langem Prozess 2017 anerkannt wurde. Entsprechend finden sich seit einigen Jahren in den KZ-Gedenkstätten zunehmend Gedenkzeichen, die an die Geschichte ihrer Verfolgung erinnern. Ähnlich entwickelt sich die öffentliche Erinnerung an die im Nationalsozialismus als "asozial" oder kriminell Verfolgten.
Erinnerungsprotest
Dem Status der Gedenkwürdigkeit voraus gingen in nahezu allen Fällen „Erinnerungsproteste“: Kommemorative Praxen, mit deren Hilfe sich Minderheiten zu Wort melden und Aufmerksamkeit beanspruchen. Die Historikerin Jenny Wüstenberg unterscheidet zwischen einem „öffentlichen Gedenken, das die Mehrheitsmeinung repräsentiert und einem Gedenken, das Werte fördert, die die Mehrheitsmeinung herausfordern könnten.“ Es gibt also eine „Grundspannung zwischen einem repräsentativen und einem normativen Gedenkregime“ (Wüstenberg 2020: 20ff). In Deutschland existiert eine Tradition öffentlichen Gedenkens, das auf normative bzw. auch politische Veränderung zielt: Erinnert sei etwa an die Begräbnisumzüge der Sozialdemokratie im frühen Kaiserreich, die erstmals 1873 im Gedenken an die Märzgefallenen von 1848 durchgeführt wurden und die immer wieder mit politischen Manifestationen verbunden waren: Diese Umzüge fochten „obrigkeitlich-polizeiliche Kontrollansprüche über öffentlichen Raum wenigstens für eine Zeit an, setzten sie zum Teil sogar momentan außer Kraft“ (Lüdtke 1991: 140).
Ein eindrucksvolles Beispiel eines Erinnerungsprotestes in jüngerer Vergangenheit ist der Hungerstreik von elf Sinti in der KZ-Gedenkstätte Dachau 1980: Vier von ihnen waren Überlebende des Völkermordes, von denen wiederum drei in gestreifter Häftlingskleidung an der mehrtägigen Aktion teilnahmen, um an die andauernde Diskriminierung von Roma und Sinti zu erinnern. Der Verweis auf die nationalsozialistische Verfolgungspraxis wie auch die Aneignung NS-spezifischer Verfolgungskategorien ist mittlerweile eine verbreitete Strategie marginalisierter Gruppen, um emanzipatorische Anliegen durchzusetzen. So diente der Rosa Winkel schwulen Männern schon in den späten 1970er Jahren als Identitätsmarker, um auf die Kontinuität der – auch strafrechtlichen – Verfolgung von Homosexualität in der Bundesrepublik hinzuweisen. Der Paragraf 175 wurde dann vom Deutschen Bundestag 1994 abgeschafft.
Erinnerungsprotest ist notwendig. Und wenn – wie jüngst am vom Bundestag eingeführten „Veteranentag“ – Menschen unter dem Motto „Wir feiern Eure Kriege nicht“ gegen die Remilitarisierung der Gesellschaft protestieren und sich zur Erinnerung an die Toten beider Weltkriege auf die Erde legen, dann ist das ein gutes Zeichen. Denn Einsprüche, plurale Geschichtsbilder und kontroverse Positionen sind für die demokratische Verfasstheit einer Gesellschaft unabdingbar.
Assmann, Aleida: Erinnerungsräume. Formen und Wandel des kulturellen Gedächtnisses, München 1999.
Durkheim, Emile: Die elementaren Formen religiösen Lebens, Frankfurt am Main 1994.
Eschebach, Insa: Öffentliches Gedenken. Deutsche Erinnerungskulturen seit der Weimarer Republik, Frankfurt am Main 2005.
Eschebach, Insa: Queere Gedächtnisräume. Zivilgesellschaftliches Engagement und Erinnerungskonkurrenzen im Kontext der Gedenkstätte Ravensbrück, in: Invertito. Jahrbuch für die Geschichte der Homosexualitäten, 21 (2019), S. 49–73.
Lange, Carmen: Die Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung durch Hammer und Sichel auf einer Kranzschleife. Zur Entstehungsgeschichte der Gedenkstätte Neuengamme, in: Morsch, Günter (Hrsg.): Von der Erinnerung zum Monument. Die Entstehungsgeschichte der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen, Berlin 1996, S. 11–124.
Lüdtke, Alf: Trauerritual und politische Manifestation. Zu den Begräbnisumzügen der deutschen Sozialdemokratie im frühen Kaiserreich, in: Warneken, Bernd Jürgen (Hrsg.): Massenmedium Straße. Zur Kulturgeschichte der Demonstration, Frankfurt am Main/New York 1991, S. 120–148.
Nietzsche, Friedrich: Unzeitgemäße Betrachtungen. Zweites Stück: vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, in: ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Bd.1, München 1980, S. 243–334.
Tietz, Jürgen: Das Tannenberg-Nationaldenkmal. Architektur, Geschichte, Kontext, Berlin 1999.
Vehse, Paul: Gedenken und Anerkennung. Zur Bedeutsamkeit von sozialer Wertschätzung in der Gedenkstättenpädagogik, in: Eschebach, Insa (Hrsg.): Was bedeutet Gedenken? Kommemorative Praxis nach 1945, Berlin 2023, S. 211–227.
Wüstenberg, Jenny: Zivilgesellschaft und Erinnerungspolitik in Deutschland seit 1945, Berlin 2020.
zur Nieden, Susanne: Unwürdige Opfer. Die Aberkennung von NS-Verfolgten in Berlin 1945 bis 1949, Berlin 2003.
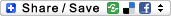
- |
- Seite drucken
- |
- 24 Sep 2025 - 11:48

