Die Nationalfeiertage in Frankreich am 14. Juli, in Polen am 3. Mai oder in den USA am 4. Juli blicken auf eine jahrhundertelange, teils unterbrochene Tradition zurück. Sie erinnern an gemeinsame Werte, an erste Verfassungen oder die nationale Unabhängigkeit. Diese Tage sind tief im kollektiven Gedächtnis verankert, werden landesweit gefeiert und sind fester Bestandteil schulischer Bildung.
Anders in Deutschland: Der 3. Oktober wurde vor genau 35 Jahren im Einigungsvertrag als gesetzlicher Feiertag festgelegt. Das Ziel war, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen nach Jahrzehnten der Teilung zu stärken und die staatliche Einheit zu festigen. Nachdem Deutschland über 40 Jahre in DDR und Bundesrepublik geteilt war, beschloss die erste frei gewählte Volkskammer den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik nach Artikel 23 des Grundgesetzes.
Der Tag der Deutschen Einheit griff keine gewachsenen Traditionen auf – und war damit unbelastet. In der DDR wurde bis 1989 der 7. Oktober als „Tag der Republik“ gefeiert, während in der Bundesrepublik und in West-Berlin der 17. Juni an den Volksaufstand von 1953 erinnerte. Auch der 9. November, der Tag des Mauerfalls, war als Nationalfeiertag im Gespräch. Doch seine historische Mehrdeutigkeit, besonders die Reichspogromnacht von 1938, stand einer Benennung zum offiziellen Feiertag entgegen. Gleichwohl bleibt der 9. November ein zentrales Erinnerungsdatum. Die Kultusministerkonferenz (KMK) und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur regen mit dem Projekttag zur deutsch-deutschen Geschichte eine intensive Beschäftigung mit diesem Tag an.
Die Friedliche Revolution und die deutsche Einheit sind in den Curricula aller 16 Bundesländer verankert. Unter Überschriften wie „Das geteilte Deutschland und die Wiedervereinigung“, „Die Friedliche Revolution 1989 und Deutsche Einheit als Herausforderung und Prozess“ oder „Bedeutung des Vereinigungsprozesses für das nationale Selbstverständnis der heutigen Bundesrepublik Deutschland“ wird das Thema behandelt. Doch das konkrete Datum – der 3. Oktober – erscheint bislang nur in fünf Bundesländern ausdrücklich im Lehrplan. Mit der wachsenden Bedeutung geschichtskultureller Perspektiven bietet die Einbindung dieses Feiertags – einschließlich seiner Vor- und Nachgeschichte – im Geschichts-, Politik- oder Deutschunterricht eine wertvolle Chance: Jugendliche können aus historischer Perspektive diskutieren, wie es um die innere Einheit Deutschlands bestellt ist, welche Unterschiede fortbestehen und was sie für unser Zusammenleben bedeuten.
Wie lässt sich eine aktive, dezentrale Erinnerungskultur zum Tag der Deutschen Einheit stärken – eine, die insbesondere jungen Menschen Zugänge eröffnet zu einem einzigartigen historischen Wendepunkt? Ziel schulischer und historisch-politischer Bildungsarbeit sollte es sein, den 3. Oktober als Impuls für eine Auseinandersetzung mit der jüngeren deutschen Geschichte zu nutzen. Die Nachwirkungen der Einheit sind bis heute spürbar; ein Denken in Ost-West-Kategorien erfährt mitunter neue Resonanz – auch bei der Generation Z. Nicht ein verordneter Konsens, sondern multiperspektivische Zugänge sind der Schlüssel zu einer lebendigen Erinnerungskultur.
Das vorliegende LaG-Magazin leistet hierzu einen Beitrag. Es bietet Lehrkräften, politischen Bildnerinnen und Bildnern und Interessierten einen aktuellen Einblick über Forschung und Diskussionen rund um den 3. Oktober sowie in einem weiteren Rahmen über die deutsche Feiertags- und Gedenkpraxis. Die Bundesstiftung Aufarbeitung unterstützt diese Auseinandersetzung durch analoge und digitale Materialien für eine zäsurübergreifende Beschäftigung mit Friedlicher Revolution und deutscher Einheit – sowohl im Unterricht als auch in der außerschulischen Bildung.
Die Posterausstellung „Friedliche Revolution und deutsche Einheit kompakt“ eröffnet anhand von Karten und illustrierten Zeitleisten zahlreiche Anknüpfungspunkte für die Bildungsarbeit. Fünf Ausstellungstafeln zeichnen die globalen Rahmenbedingungen, die Entwicklungen in Ostmitteleuropa, die Friedliche Revolution, die Selbstdemokratisierung der DDR sowie den Weg zur deutschen Einheit nach.
Ergänzt wird dieses Angebot durch das Webportal www.deutsche-einheit-1990.de mit Quellen, Interviews, Fotos und didaktischen Materialien. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen verleihen den historischen Umbrüchen ein Gesicht und ermöglichen differenzierte Einblicke in biografische Erfahrungen – auch rund um den 3. Oktober.
Vielleicht braucht es mehr als einen Feiertag – aber gerade dieser lädt dazu ein, sich immer wieder neu mit unserer gemeinsamen Geschichte auseinanderzusetzen.
Katharina Hochmuth
Leiterin des Arbeitsbereichs Schulische Bildungsarbeit
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
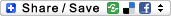
- |
- Seite drucken
- |
- 24 Sep 2025 - 10:47

