Eine „ehrenvolle nationale Pflicht“. Zur Geschichte des Wehrdienstes in der DDR
Rüdiger Wenzke
Mit dem Wehrpflichtgesetz vom 24. Januar 1962 wurde in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Bereits kurze Zeit später, am 4. April 1962, rückten die ersten Wehrpflichtigen in die Kasernen der Nationalen Volksarmee (NVA) ein. Für Generationen junger Männer in der DDR wurde der Wehrdienst von nun an zu einem festen Bestandteil ihrer Biografie.
Die Kasernierte Volkspolizei im Zeichen der geheimen Aufrüstung (1949 bis 1956)
Bereits bei der Gründung der DDR im Oktober 1949 gehörten erste militärähnliche Formationen zum Machtapparat des sich etablierenden kommunistischen Regimes. Freilich war zu dieser Zeit alles Militärische offiziell noch verpönt, so dass der mit tatkräftiger Unterstützung der Sowjetunion einsetzende Aufbau von ostdeutschen Streitkräften anfangs nur im Geheimen, getarnt als kasernierte Polizei, erfolgen konnte (Diedrich/Wenzke 2003: 13−96). Der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), der alles bestimmenden Staatspartei in der DDR, ging es vor allem darum, rasch einen politisch verlässlichen Kaderstamm für eine künftige reguläre Armee aufzustellen und zu formen. Tatsächlich meldeten sich tausende Jugendliche freiwillig und aus Überzeugung zum Waffendienst, der seit 1952 in der Kasernierten Volkspolizei (KVP) abgeleistet werden konnte. Viele junge Männer in der DDR standen jedoch einem Militärdienst – gleich welcher Art – ablehnend gegenüber. Um dennoch das erforderliche und geeignete Personal zu erhalten, nahmen die Methoden der Partei- und Staatsführung für die Werbung und Rekrutierung schon frühzeitig rigide Formen an, wie etwa Einschränkungen bei der Berufswahl oder bei der Zuteilung von Studienplätzen. 1955 fixierte die ostdeutsche Verfassung den Dienst „zum Schutz des Vaterlandes“ als „ehrenvolle nationale Pflicht“ der Bürger der DDR (Gesetzblatt DDR 1955: 653).
Wehrdienst (noch) ohne Wehrpflicht (1956 bis 1962)
Im Januar 1956 wurde die NVA, auf der Grundlage der KVP, als reguläre Streitkräfte offiziell gegründet (Wenzke 2014: 40−47). Überraschenderweise verzichtete die SED-Führung auf die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Der Wehrdienst blieb vorerst eine „freiwillige Dienstleistung“. Für die anfängliche Beibehaltung des Freiwilligensystems waren vor allem politische und propagandistische Gründe ausschlaggebend. So erhoffte sich die SED eine politische und moralische Aufwertung ihrer eigenen Armee gegenüber der westdeutschen Bundeswehr, für die im Sommer 1956 die Wehrpflicht eingeführt wurde. Der entscheidende Grund für die vorläufige Beibehaltung des Freiwilligensystems im Osten war jedoch in der damals noch offenen Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten und zu West-Berlin zu sehen, die jederzeit ein Ausweichen der wehrdienstpflichtigen Jugendlichen ermöglichte. Die NVA blieb also im Verlauf der folgenden Jahre offiziell – und damit als Ausnahme im Bündnis des Warschauer Paktes – eine Freiwilligenarmee. Staatsorgane, Betriebe, Schulen, Parteien und Massenorganisationen übten allerdings einen permanenten politischen und moralischen Druck auf die Jugendlichen im wehrfähigen Alter aus, um deren Bereitschaft zum „freiwilligen“ Eintritt in die NVA zu erreichen. Doch nachlassende Werbeerfolge und demografische Entwicklungen gefährdeten zunehmend die personelle Auffüllung und damit auch den weiteren Aufbau der NVA. Den Ausweg aus diesem Dilemma bot nur die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht. Es verwundert daher nicht, wenn nur wenige Monate nach dem Mauerbau vom August 1961 die Volkskammer, das gesetzgebende Organ in der DDR, am 24. Januar 1962 einstimmig das Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht (Wehrpflichtgesetz) verabschiedete.

Vereidigung erster NVA-Einheiten, 30. April 1956 in Oranienburg © Walter Heilig, Bundesarchiv, Bild 183-37818-0004 / CC BY-SA 3.0 DE, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-37818-0004,_Oranienburg,_Vereidigung_erster_NVA-Einheiten.jpg
Allgemeine Wehrpflicht und die weitere Militarisierung der Gesellschaft (1962 bis 1990)
Das Wehrpflichtgesetz stellte eine bedeutende Zäsur in der Entwicklung der ostdeutschen Landesverteidigung dar. Es konfrontierte nunmehr alle wehrfähigen männlichen Bürger der DDR erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg direkt und unausweichlich mit dem Wehrdienst. Die meisten von ihnen hatten keine Vorstellung davon, was sie „bei der Fahne“ erwartete (Wenzke 2013: 325−338). Die Mehrheit der männlichen Jugendlichen kam gezwungenermaßen ihrer gesetzlichen Pflicht zum Dienst in der NVA nach – ohne Begeisterung und mit dem Vorsatz, den Wehrdienst möglichst unbeschadet hinter sich zu bringen.
Das Wehrpflichtgesetz regelte die allgemeine Wehrpflicht in der DDR und legte die Rechte und Pflichten der Angehörigen der NVA fest. Dazu gehörte die Verpflichtung, sich zur Erfassung zu melden, zur Musterung und zur Diensttauglichkeitsuntersuchung zu erscheinen und den Wehrdienst als aktiven Dienst oder Reservistenwehrdienst abzuleisten. Ein Fahneneid nach sowjetischem Muster verpflichtete die Soldaten dazu, jederzeit bereit zu sein, „den Sozialismus gegen alle Feinde zu verteidigen“ (Gesetzblatt DDR 1962: 12).

Ein Musterungsstützpunkt der NVA in Kamenz, 10. April 1964 © Walzel (Militärbilddienst), Militärhistorisches Museum der Bundeswehr Dresden, Sammlung Bildgut, BAAK5405
Die allgemeine Wehrpflicht erstreckte sich auf die männlichen Bürger der DDR vom 18. bis zum vollendeten 50. Lebensjahr. Bei Offizieren endete sie mit der Vollendung des 60. Lebensjahres. Im Verteidigungsfall unterlagen alle männlichen Bürger zwischen 18 und 60 Jahren der Wehrpflicht. Die Dauer des Grundwehrdienstes wurde in Anlehnung an die Regelungen der Wehrpflicht in der Bundesrepublik auf 18 Monate festgelegt. Große Bedeutung maß die DDR dem Reservistenwehrdienst bei. Alle gedienten und ungedienten Wehrpflichtigen bis zur Vollendung des 50. bzw. 60. Lebensjahres gehörten der Reserve der NVA an. Sie konnten zu Übungen und zur Überprüfung ihrer Kampffähigkeit kurzfristig einberufen werden.
Die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht bildete nicht nur eine wichtige Voraussetzung für die weitere Entwicklung der NVA als Bündnispartner im Warschauer Pakt, sondern forcierte auch den Prozess der gesellschaftlichen Militarisierung in der DDR. Der Wehrdienst sollte in diesem Sinne disziplinierend und indoktrinierend auf die Jugend wirken. Massenorganisationen wie die Gesellschaft für Sport und Technik (GST) und die Freie Deutsche Jugend (FDJ) waren verpflichtet, zur Erhöhung der Wehrbereitschaft der Bevölkerung beizutragen. Bereits in der Schulzeit spielte die Ausbildung der Jungen und Mädchen in Form von Wehrunterricht, Wehrlagern und militärähnlichen Übungen eine wichtige Rolle für die vormilitärische Vorbereitung auf den Wehrdienst oder für eine Tätigkeit in der Zivilverteidigung. Zudem erhielten jährlich zehntausende männliche Hoch- und Fachschulstudenten während ihres Studiums eine militärische Ausbildung und Qualifizierung. Für Studentinnen war eine mehrwöchige Zivilschutzausbildung Pflicht.
Über zwei Jahrzehnte hinweg regelte das Wehrpflichtgesetz von 1962 die Wehrpflicht und den Wehrdienst in der DDR. Im März 1982 wurde ein neues Wehrdienstgesetz verabschiedet. Zwar blieben grundlegende Regelungen des alten Wehrpflichtgesetzes wie die Dauer des Grundwehrdienstes oder der Fahneneid unverändert, doch kam es – auch aufgrund der demografischen Situation – ab Mitte der 1980er Jahre zu einigen Veränderungen im Wehrdienst. So wurde ein größerer Teil der jährlich Einzuberufenden erst im Alter von 23 bis 26 Jahren statt wie bisher mit 18 Jahren eingezogen. Darüber hinaus sollten künftig wesentlich mehr Frauen als Berufs- oder Zeitsoldaten gewonnen werden. Bereits seit Gründung der NVA war es Frauen gestattet, sich freiwillig zur NVA zu melden und dort als Zivilangestellte oder auch in Uniform tätig zu werden. Weibliche Armeeangehörige wurden im Laufe der Jahre immer stärker in militärische Dienststellungen integriert. 1984 begannen Frauen erstmalig eine Offiziersausbildung. Zivile Studienbewerber in wissenschaftlich-ökonomischen Fachrichtungen brauchten nur noch einen verkürzten Wehrdienst abzuleisten. Mehr Aufmerksamkeit als bisher galt auch der Sicherung des Nachwuchses für militärische Berufe und den freiwilligen Wehrdienst auf Zeit. Insbesondere die Gruppe der Unteroffiziere auf Zeit (UaZ) mit einer Regeldienstzeit von drei oder vier Jahren rekrutierte sich zu einem erheblichen Anteil aus Abiturienten, die sich oft nur mit der freiwilligen Verpflichtung für einen längeren Wehrdienst den gewünschten Studienplatz sichern konnten (Müller 2003: 87−106).
Von Beginn an sollten die jungen DDR-Bürger in Uniform während ihres Wehrdienstes zu „sozialistischen Soldatenpersönlichkeiten“ erzogen und ausgebildet werden. Neben Eigenschaften wie Tapferkeit, Gehorsam und Mut zählten vor allem Treue zur SED und der DDR, Freundschaft mit der Sowjetunion sowie Hass gegenüber dem „Klassenfeind“ zu den entscheidenden Kriterien des neuartigen Soldatentypus (Losse/Glaß 1975: 145). Der Alltag in der Kaserne entsprach freilich nicht der SED-Propaganda vom neuen sozialistischen Soldaten und vom vorbildlichen Zusammenleben in Soldatenkollektiven. Tatsächlich wurde das gesamte Leben der Armeeangehörigen von den Forderungen der „Ständigen Gefechtsbereitschaft“ bestimmt. Das hieß unter anderem, dass 85 % des Personalbestandes und der Kampftechnik ständig präsent sein mussten. Besonders für die Grundwehrdienstleistenden bedeutete dies eine harte Ausbildung, viele Übungen, politische Indoktrination, wenig Freizeit, Urlaub und Ausgang, ein rigides Dienstregime mit vielfältigen Disziplinierungs- und Repressionsmitteln sowie eine ständige Bevormundung und Kontrolle durch Vorgesetzte. Der Wehrdienst stellte sich so für viele Wehrpflichtige bis zum Ende der 1980er Jahre als soziale Ausnahmesituation dar.
Alternativen zum Wehrdienst
Ein verfassungsmäßig garantiertes Recht der Kriegsdienstverweigerung oder einen Zivildienst wie in der Bundesrepublik gab es in der DDR bis Anfang 1990 nicht. Auch der von der evangelischen Kirche geforderte soziale Friedensdienst konnte nicht durchgesetzt werden. Gegner der Wehrpflicht und des Wehrdienstes wurden von der SED vielmehr mit Feinden des Friedens und des Sozialismus gleichgesetzt und gesellschaftlich geächtet. In der DDR gab es rund 7.500 grundwehrdienstpflichtige Totalverweigerer, die aus überwiegend politischen und religiösen Motiven jeglichen Wehr- und Wehrersatzdienst ablehnten. Darunter befanden sich vor allem Angehörige der Zeugen Jehovas, deren Glaubensbekenntnis einen Waffendienst generell verbietet. Die Strafbestimmungen der Wehrgesetze sahen für Totalverweigerer Freiheitsstrafen vor, die in der Regel über die 18-monatige Wehrpflichtzeit hinausreichten. Allerdings schuf die DDR-Führung 1964 vor dem Hintergrund steigender Verweigerungszahlen und auf Druck der Kirchen die Möglichkeit eines waffenlosen Wehrdienstes. Diese im Warschauer Pakt bis dahin einmalige Regelung sah vor, dass Wehrpflichtige, vor allem religiös gebundene Bürger, ihren Dienst in so genannten Baueinheiten ohne Waffe ableisten konnten. Die als Bau- oder auch als Spatensoldaten bezeichneten NVA-Angehörigen hatten vor allem die Aufgabe, Arbeitsleistungen innerhalb oder außerhalb der Streitkräfte zu erbringen. Ihre Dienstzeit betrug 18 Monate. Sie konnten im Unterschied zu den „normalen“ Soldaten weder befördert noch degradiert werden und legten statt des Fahneneides ein Gelöbnis ab. Nach Beendigung ihres Wehrdienstes mussten die Bausoldaten häufig Nachteile beim Studium und im Beruf hinnehmen (Eisenfeld/Schicketanz 2011: 366−381).

Schulterstück eines Bausoldaten in der DDR, 24.02.2019 © Schäfer-Hartmann / CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bausoldat_Schulterstueck.jpg
Wehrdienst im Umbruch 1989/90
Der Wehrdienst galt in der DDR als „Ehrenpflicht“. Die SED nutzte die Möglichkeiten der Wehrpflicht und des Wehrdienstes, um ihre Politik der militärischen Macht, der politischen Indoktrination und gesellschaftlichen Militarisierung durchzusetzen. Erst die Friedliche Revolution 1989/90 schuf die Voraussetzungen für eine grundlegende Neuregelung der Wehrpflicht und des Wehrdienstes in der DDR. Im April 1990 verabschiedete die Volkskammer ein Gesetz, das erstmals Wehrpflicht und Zivildienst als gleichberechtigte Dienstpflichten für männliche Bürger einführte. Die Dauer dieser Dienstpflicht betrug nunmehr einheitlich 12 Monate. Am 2. Oktober 1990, 24.00 Uhr, endeten die Geschichte der DDR, ihrer Armee und somit auch die Geschichte des Wehrdienstes in den ostdeutschen Streitkräften.
Literatur
Bröckermann, Heiner: Landesverteidigung und Militarisierung. Militär- und Sicherheitspolitik der DDR in der Ära Honecker 1971–1989 (= Militärgeschichte der DDR 20), Berlin 2011.
Diedrich, Torsten/Wenzke, Rüdiger: Die getarnte Armee. Geschichte der Kasernierten Volkspolizei der DDR 1952 bis 1956 (= Militärgeschichte der DDR 1), 2. Aufl., Berlin 2003.
Eisenfeld, Bernd/Schicketanz, Peter: Bausoldaten in der NVA. Die „Zusammenführung feindlich-negativer Kräfte“ in der NVA (= Forschungen zur DDR-Geschichte), Berlin 2011.
Erlass des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik über den aktiven Wehrdienst in der Nationalen Volksarmee (Dienstlaufbahnordnung) vom 24. Januar 1962, Anlage 1: Fahneneid, in: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik 1962 I, S. 6–12, hier: S. 12.
Gesetz zur Ergänzung der Verfassung vom 26. September 1955, in: Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik 1955 (Website), URL: https://www.verfassungen.de/ddr/verfassungsgesetz55.htm [eingesehen am 17.05.2025].
Losse, Alwin/Glaß, Lothar: Wehrmoral und Soldatenethos im Sozialismus, Berlin (Ost) 1975.
Müller, Christian Th.: Tausend Tage bei der „Asche“. Unteroffiziere in der NVA. Untersuchungen zu Alltag und Binnenstruktur einer „sozialistischen“ Armee (= Militärgeschichte der DDR 6), Berlin 2003.
Wenzke, Rüdiger: Ulbrichts Soldaten. Die Nationale Volksarmee 1956 bis 1971 (= Militärgeschichte der DDR 22), Berlin 2013.
Wenzke, Rüdiger: Nationale Volksarmee. Die Geschichte, München 2014.
Wenzke, Rüdiger: Geschichte der Nationalen Volksarmee 1956−1990, 2. überarb. Aufl., Erfurt 2017.
Wenzke, Rüdiger: Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht in der Deutschen Demokratischen Republik vom 24.1.1962, in: 100(0) Schlüsseldokumente zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert (Website), URL: https://www.1000dokumente.de/Dokumente/Gesetz_%C3%BCber_die_allgemeine_Wehrpflicht_der_Deutschen_Demokratischen_Republik#Einf%C3%BChrung[TR2] [eingesehen am 12.03.2025].
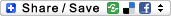
- |
- Seite drucken
- |
- 2 Jul 2025 - 08:06

