Die MEMO-Studien zur Erinnerungskultur in Deutschland. Im Gespräch mit Jonas Rees und Leonore Martin
LaG: Die MEMO-Studie zur Erinnerungskultur in Deutschland gibt es seit 2018. Welches Ziel verfolgt die Studie?
Jonas Rees: Bereits 2017 haben wir gemeinsam mit der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft den Multidimensionalen Erinnerungsmonitor MEMO aufgelegt. Die Idee dahinter war, wenn man es ganz einfach sagen will: die Zahlen zu den Diskussionen rund um die Erinnerungs- und Gedenkkultur in Deutschland zu liefern. Das war so eine Art Leerstelle, denn es gab und gibt darüber hinaus lediglich vereinzelt und unsystematisch Studien, die sich mit konkreten Aspekten von Erinnern und Gedenken auseinandersetzen. Entsprechend den wissenschaftlichen Standards der Studie ist ein Kernelement die regelmäßig durchgeführte Repräsentativbefragung. Die hier gestellten Fragen richten sich danach, was aus Sicht von Menschen in Deutschland wichtige Themen sind, insbesondere im Bereich Erinnerung an den Nationalsozialismus, aber auch, wie sie sich über diese Zeit informieren, was sie wissen – und manchmal auch, was sie glauben zu wissen.
LaG: Wie haben sich seit 2018 die inhaltlichen Schwerpunkte verändert? Kann man eine Geschichte der MEMO-Studie mit sich wandelnden Schwerpunkten erzählen? Und warum wurde 2023 eine MEMO-Studie mit Jugendlichen aufgelegt?
Jonas Rees: Für mich ist MEMO inzwischen eine Art Sammelbegriff, das sind unterschiedlich angelegte Studien. In der MEMO-Jugendstudie haben wir über 3.000 Menschen im Alter zwischen 16 und 25 befragt. Wenn Sie Studienergebnisse vorstellen, ist eine der häufigsten Fragen: Was spielt das Alter für eine Rolle? Wir sind immer wieder in ganz unterschiedlichen Kontexten auf diese Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gestoßen. Das betrifft Fragen wie: Was lernen Jugendliche in der Schule oder womit setzen sie sich aktuell auseinander? Auch im Kontext der Erinnerungs- und Gedenkkultur war das natürlich eine Gruppe von besonderem Interesse. So war es für uns naheliegend zu entscheiden: Dann machen wir eine Studie dazu.
Über die Jahre, das ist mir persönlich ganz besonders wichtig, hat sich eine Art Begleitrunde entwickelt: der MEMO-Expert:innenkreis. In ihm sitzen Forschende, aber auch Autor:innen und insbesondere Praktiker:innen aus dem Bereich der Erinnerungs- und Gedenkkultur. Wir versuchen ja, die Fragen aus der Praxis in solche im Fragebogen zu übertragen und in interpretierbare Zahlen zu übersetzen. Das wäre ohne die Anregungen und Ideen aus dem MEMO-Expert:innenkreis gar nicht möglich. Thomas Eppenstein, ein Kollege aus diesem Kreis, hat die Bezeichnung „MEMO-Raumschiff“ geprägt. Und ich glaube, MEMO ist gleich in doppeltem Sinne ein Raumschiff, das einerseits die Draufsicht auf den Stand der Erinnerungs- und Gedenkkultur in Deutschland ermöglicht und andererseits einen Raum für Diskussionen schafft. Auf der Grundlage von Zahlen kann über Fragen gesprochen werden wie: Was bewegt die Menschen? Worüber denken sie nach? Und Praktiker:innen der Bildungsarbeit bietet es eine Art Realitätscheck: Wie viel kommt eigentlich an von dem, was wir machen?
LaG: Frau Martin, war das der Hauptbeweggrund der Stiftung EVZ, auf das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung Bielefeld zuzugehen: Ging es um belastbare Zahlen, um Statistiken zum vorhandenen historischen Wissen besonders über die Zeit des Nationalsozialismus?
Leonore Martin: Die grundsätzliche Intention war, empirisch überprüfen zu lassen: Wie wirksam ist die Arbeit der Stiftung und wo liegen die Bedarfe? Die gewonnenen Erkenntnisse und Daten sind in unsere praktische Fördertätigkeit eingeflossen. Natürlich werden die Fragen dem Institut (IKG) nicht von der Stiftung vorgegeben, sondern gemeinsam in einem langen Prozess unter Einbezug verschiedener Perspektiven entwickelt.
Jonas Rees: Wir haben in Abstimmung mit der Stiftung EVZ den Fokus auf die Zeit des Nationalsozialismus gelegt, aber das Forschungsdesign ist nicht in jeder Hinsicht darauf eingeengt. An manchen Stellen müssen wir in geschlossenen Formaten fragen, Themen vorgeben und auch eine Auswahl treffen, aber an anderen Stellen können wir offen fragen und abbilden, dass Erinnerung vielfältig ist. Die NS-Zeit einerseits und die deutsche Teilung und Wiedervereinigung andererseits, das sind die zwei großen wiederkehrenden Erzählungen. Auf die Frage, welche historischen Ereignisse unseren Befragten wichtig sind, erhalten wir aber auch noch andere Antworten: von der Einführung des Frauenwahlrechts über das Kaiserreich bis zur eigenen Hochzeit.
LaG: Herr Rees, welche zentralen Befunde und Erkenntnisse haben Sie im Laufe der verschiedenen Studien herausgefunden?
Jonas Rees: Ein wiederkehrender Befund ist, dass wir es mit einer sehr lebendigen und vielfältigen Erinnerungs- und Gedenkkultur in Deutschland zu tun haben. Weil Sie die MEMO-Jugendstudie 2023 angesprochen haben: Jugendliche und junge Erwachsene sind beispielsweise interessierter an der NS-Zeit und an der deutschen Geschichte, als man ihnen oft unterstellt. Bei genauerem Nachfragen stellen wir jedoch fest: Das Faktenwissen ist nicht immer vorhanden, sondern häufig eher eine Art gefühltes Wissen. Auf eine der Fragen: Wann war denn genau die NS-Zeit? konnte nur die Hälfte der Befragten richtig antworten, ein Großteil antwortete darauf nur unzureichend und 16 % versuchten es erst gar nicht. Auch war über die Jahre hinweg ein Befund, dass sich die deutsche Erinnerungskultur in einem Umbruch befindet, u. a. durch nationalistische Geschichtsumdeutungen rechtsextremer Akteur:innen, die versuchen, Diskurse zu vereinnahmen. Die Erinnerungskultur ist Angriffen ausgesetzt und es zeigt sich dann, wie fragil sie teilweise ist.
LAG: Frau Martin, wie nutzt die Stiftung EVZ die Ergebnisse der Studien, etwa bei der Konzeption von neuen Förderprogrammen?
Leonore Martin: Da kann ich Ihnen ein ganz aktuelles Beispiel geben. Wir hatten in der Jugendstudie gefragt: „Welche Möglichkeit ist für Dich die beste, sich mit der Zeit des Nationalsozialismus zu beschäftigen, oder was hat Dir am meisten gebracht?“ Mehr als 40 % der Befragten sagten dazu, dass für sie Filme am sinnvollsten für die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus sind, und zwar größtenteils Dokumentarfilme, seltener Spielfilme. Wir haben das sehr ernst genommen und einen Kinotag konzipiert. Er heißt „Augen auf-Kinotag zum 27. Januar“ und lief anlässlich des jährlichen Gedenktags an die Opfer des Nationalsozialismus 2025 in drei Städten mit öffentlichen und schulischen Filmvorführungen und begleitenden Bildungsformaten. Geplant ist, das Projekt ab 2026 auszuweiten.
LaG: Können Sie, Frau Martin, sagen, wie die Studie rezipiert wird? Wer liest die Ergebnisse?
Leonore Martin: Die MEMO-Studie gilt als wirklich umfassendste Studie ihrer Art. Und sie wird auf verschiedene Weise öffentlich rezipiert, besonders wenn die neuen Umfrageergebnisse erscheinen. Diese werden dann oft in Medienberichten zitiert, große Leitmedien sind dabei, etwa Die Zeit oder die taz, was natürlich zur breiten öffentlichen Wahrnehmung beiträgt.
Es gibt Veranstaltungen, Konferenzen und Publikationen, die die Ergebnisse der MEMO-Studien nutzen, um aktuelle Debatten mit Fakten zu bereichern, zu informieren und auch um Handlungsoptionen und Bedarfe abzuleiten. Zum Beispiel das Angebot RESPEKT des Bayerischen Rundfunks: In Erklärvideos und Formaten mit Zusatzinformationen zu Demokratie und Toleranz ist die MEMO-Studie als Quelle angegeben. Die MEMO-Studie hat eine Rolle gespielt in der kontroversen Diskussion um den Instagram-Kanal @ichbinsophiescholl. Da wurden in der Argumentation Zahlen und Fakten aus MEMO eingebaut. Die Bildungsstätte Anne Frank hat das Themenheft Wie die Rechten die Gesellschaft umdeuten. Geschichtsrevisionismus und Antisemitismus herausgegeben, auch dort steht in den Quellen die MEMO-Studie. Diese und viele andere Beispiele zeigen: Es gibt eine umfassende Nutzung in verschiedenen Medienarten.
Ich würde gerne noch ein weiteres Beispiel bringen, was mich selbst sehr beeindruckt hat. Die Autorin Anne Rabe hat 2023 den autofiktionalen Roman Die Möglichkeit von Glück veröffentlicht, der sogar für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Es geht darin um eine drei Generationen umfassende Familiengeschichte, die beim Großvater der Ich-Erzählerin beginnt. Der Großvater hatte den Zweiten Weltkrieg erlebt, später als Lehrer und Propagandist am Aufbau der DDR mitgearbeitet. Die Autorin versucht, die Lücken in den Familienerzählungen zu schließen und nach dem zu forschen, was bisher nicht erzählt worden ist. In diesem literarischen Werk, einer Verbindung von Essay, Archivrecherche und Autofiktion, zitiert Rabe die MEMO-Studie. In dem Buch geht es um Gewalt in der ehemaligen DDR und innerhalb der Familie sowie darum, was das mit dem Nationalsozialismus zu tun hat. Das ist medial sehr kontrovers diskutiert worden und fiel auch in den Ost-West-Diskurs, der durch Dirk Oschmanns Buch Der Osten: eine westdeutsche Erfindung ausgelöst wurde. Wenn die MEMO-Studie sogar den literarischen Raum erreicht hat, unterstreicht das in meinen Augen ihre Bedeutung.
LaG: Ich beziehe mich nun auf den Schwerpunkt der jetzigen Ausgabe des LaG-Magazins: Erinnerung an 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Gibt es in den bisherigen MEMO-Studien Ergebnisse dazu: Was wissen Jugendliche und Erwachsene speziell über das Kriegsende und die Nachkriegszeit?
Jonas Rees: Wir haben in der MEMO-Studie 2020 gefragt: „Wie gut beschreiben, Ihrer Meinung nach, die nachfolgenden Begriffe, was das Ende des Zweiten Weltkriegs für Deutschland bedeutet hat: ‚Befreiung‘, ‚Neuanfang‘, ‚Kapitulation‘ und ‚Niederlage‘?“ Der Begriff des „Neuanfangs“ landete dabei an zweiter Stelle. Nur knapp 6 % aller Befragten empfanden ihn als unpassend. Thomas Eppenstein und Doron Kiesel haben ihrerzeit, etwas rhetorisch natürlich, gefragt, ob das die Einzigen seien, die sich ein Bewusstsein über Kontinuitäten in der Geschichte bewahrt haben, wissend oder ahnend, dass die Rede von einem „Neuanfang“ Verdrängung und Schuldabwehr bedeutet. An erster Stelle landete übrigens der Begriff „Befreiung“, der auch nicht unproblematisch ist, weil er zur kollektiven Erzählung passt, nach der, etwas zugespitzt, die meisten Deutschen zu der Zeit das NS-System eigentlich abgelehnt hätten, selbst Unterdrückte und nicht Unterstützer:innen gewesen seien und daher nur befreit werden mussten.
In der MEMO-Studie 2022 haben wir nach europäischen Ländern gefragt, die Menschen mit dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung bringen. Da waren die mit Abstand am häufigsten genannten Länder Frankreich und Polen. Die Ukraine hingegen wurde nur von etwa 1 % der Befragten genannt, Belarus lag mit 0,4 % noch darunter. Der Krieg in Osteuropa war jedoch ein bedeutender und verheerender Teil des Zweiten Weltkriegs und gerade die Ukraine, Belarus und das Baltikum waren seine Hauptschauplätze. Allein in der Ukraine wurden mindestens 1,5 Millionen Jüd:innen ermordet.
Leonore Martin: Der namhafte US-Historiker Timothy Snyder hat kürzlich in einem Podiumsgespräch bei der Bundeszentrale für politische Bildung gesagt, ich zitiere sinngemäß: „Ich bin schockiert, wenn ich in öffentlichen Meinungsumfragen sehe, dass nur ein mikroskopisch kleiner Prozentsatz der Deutschen weiß, dass die Deutschen im Zweiten Weltkrieg einen Kolonialisierungskrieg gegen die Ukraine geführt haben.“ Ich denke, es ist nicht zu viel behauptet, dass er sich da direkt oder indirekt auch auf die MEMO-Studie bezieht. Wir kennen zumindest keine vergleichbare Studie, die diese Frage, von der Jonas Rees eben gesprochen hat, enthält.
LaG: Haben Sie in den letzten Jahren Ihre Forschungsschwerpunkte und Fragen an aktuelle politische Konstellationen angepasst oder verändert, etwa im Hinblick auf den Gaza-Krieg oder Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine?
Jonas Rees: Neben dem Grundstock an für uns relevanten Themen müssen und wollen wir auch flexibel sein und ein Stück weit auf aktuelle Entwicklungen reagieren. Wir können nach dem 7. Oktober 2023 nicht eine Studie zur Erinnerungskultur in Deutschland machen, ohne das Thema Antisemitismus aufzunehmen. Und wir kommen im Jahr 2025, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, nicht an der Frage vorbei: Wo sehen Menschen eigentlich Kontinuitäten aus der NS-Vergangenheit, die uns heute noch prägen? Wir, die zu solchen Themen forschen, wollen dazu auskunftsfähig sein.
LaG: Herr Rees, wohin bewegt sich jetzt das Raumschiff? Wie sehen die weiteren Pläne in der MEMO-Studie aus? Welche Zielrichtungen oder Schwerpunkte haben Sie für die kommenden Jahre?
Jonas Rees: Auch in diesem Jahr werden wir gemeinsam mit der Stiftung EVZ wieder eine Studie zum Stand der Erinnerungskultur in Deutschland vorlegen – die Gedenkanstoß-MEMO-Studie. Gleichzeitig versuchen wir auch, weitere Perspektiven zu erschließen. Eines der Themen, die uns jetzt 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs interessieren, ist die europäische Perspektive. Eine Lehre aus MEMO ist, dass Erinnerung auch regional verortet ist. Das betrifft sowohl die Geschichte vor der eigenen Haustür als auch den Blick auf die europäischen Orte und Regionen, die wir erinnern. Ich finde, wir wissen zu wenig darüber, wie in unterschiedlichen europäischen Ländern an den Zweiten Weltkrieg und an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnert wird. Gerade in den Zeiten der weltweiten Rückkehr des nationalen Autoritarismus bräuchten wir mehr denn je eine Art europäische Erinnerungsgemeinschaft. Wenn wir eine gemeinsame Identität entwickeln wollen, müssen wir, so glaube ich, auch über die historischen Referenzen sprechen. Deswegen wäre aus meiner Sicht ein konsequenter nächster Schritt, in MEMO die europäische Perspektive zu stärken. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann steht das ganz oben auf meiner Wunschliste.
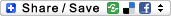
- |
- Seite drucken
- |
- 8 Mai 2025 - 09:45

